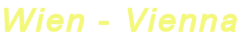Person - Karl Schönherr
Karl Schönherr (* 24. Februar 1867 in Axams, Tirol; † 15. März 1943 in Wien) war Arzt und Schriftsteller.Leben: Karl Schönherr war der Sohn Maria Suitners (* 7. April 1835 in Leiblfing) und des Dorfschullehrers Josef Schönherr (* 12. April 1836 in Obsteig). Karl Schönherr studierte zunächst Medizin und wurde zum Dr. med. promoviert. In jungen Jahren publizierte er in der Wiener Zeitung. Als Schriftsteller gelang ihm nach humoristisch angelegten Erzählungen in der Welt ländlicher Alltagsszenarien der Durchbruch; als Dramatiker mit seiner Tragödie braver Leute Die Bildschnitzer, die 1900 am Deutschen Volkstheater in Wien Premiere hatte. Zu seinen erfolgreichsten Stücken zählen Glaube und Heimat (1910) und Der Weibsteufel (1914). Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten gehörte er der politisch gesäuberten Deutschen Akademie der Dichtung an, einer Unterabteilung der Preußischen Akademie der Künste. Reichsdramaturg Rainer Schlösser bezeichnete Schönherrs schriftstellerische Tätigkeit am 9. Mai 1933 im Völkischen Beobachter als „blutechtes, bodenständiges Schaffen“. Schönherr schrieb zu dieser Zeit Werke wie Die Fahne weht (1937). Anlässlich der Volksabstimmung über den Anschluss Österreichs schrieb er im April 1938 folgende Verse: „Nun sind wir wieder ein gewaltiges Land, / so wie in alter Zeit, / das keine Welt auseinanderreißt“. Schönherr, der nach den rassistischen Nürnberger Gesetzen mit einer Jüdin verheiratet war (Malvine, 1867–1956), erhielt weiterhin Schreiberlaubnis; er verstarb 1943.
Karl Schönherr ruht in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof (Gruppe 14 C, Nummer 11).
Aufführungen und Rezeption (Auswahl): 1912 hat eine Gruppe von amerikanischen Studenten Glaube und Heimat in deutscher Sprache aufgeführt, und zwar als Studententheater am Central Wesleyan College in Missouri.
1918 hat Kardinal Faulhaber gegen die Aufführung von Der Weibsteufel in München protestiert; der bayerische König ließ das Stück vom Programm absetzen.
Auszeichnungen und Ehrungen:
1908 Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens
1908 Schiller-Preis (Preußen) für Erde
1908 Volks-Schillerpreis für Erde
1908 Bauernfeld-Preis für Erde
1911 Grillparzer-Preis
1917 Grillparzer-Preis
1920 Grillparzer-Preis
1934 Österreichisches Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft
1937 Ehrenring der Stadt Innsbruck
1937 Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft
In Innsbruck, Kufstein, Lienz, Axams, Wörgl, Telfs und Graz wurden Verkehrsflächen nach ihm benannt. In der Karl-Schönherr-Straße in Innsbruck befindet sich die Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule, in Axams trägt die Sprengelhauptschule des Westlichen Mittelgebirges den Namen Karl-Schönherr-Hauptschule. In Schlanders im Vinschgau ist das Kulturhaus nach ihm benannt.
Werke:
Inntaler Schnalzer. Gedichte, 1895
Tiroler Marterln. Gedichte, 1895
Allerhand Kreuzköpf. Erzählungen, 1895
Karrnerleut’. In: Die Presse, 29. Oktober 1895
Der Judas von Tirol. Drama, 1897
Die Bildschnitzer. Drama, 1900
Der Sonnwendtag. Drama in fünf Akten, erstmals aufgeführt 1902 im Hofburgtheater in Wien
Caritas. Erzählung, 1905
Karrnerleut. Drama, 1905
Familie. Drama, 1905; unter dem Titel Kindertragödie, 1913
Erde. Komödie des Lebens, 1907 (geschrieben in Altenberg im Haus von Adolf Lorenz)
Glaube und Heimat. Die Tragödie eines Volkes. Drama, Leipzig 1910 – Das Bühnenstück wurde zur Namensgeberin für die 1924 gegründete deutsche evangelische Kirchenzeitung Glaube und Heimat in Thüringen. Der Stummfilm Glaube und Heimat von Emerich Hanus kam 1921 erstmals auf die Leinwand.
Aus meinem Merkbuch. Erzählung, 1911
Schuldbuch. Erzählung, Leipzig 1913
Tiroler Bauernschwänke. Erzählungen, 1913
Die Trenkwalder. Komödie, 1914
Der Weibsteufel. Drama, 1914
Der Weibsteufel, Hörspielbearbeitung und Regie: Ursula Scheidle, Produktion: ORF/SWR 2019
Volk in Not. Drama, 1916
Frau Suitner. Schauspiel in fünf Akten, Leipzig 1917
Das Königreich. Volksmärchen in vier Akten. Leipzig 1917
Narrenspiel des Lebens. Drama, 1918
Der Kampf. Drama, 1920
Es. Schauspiel in fünf Akten, Leipzig 1923
Der Komödiant. Ein Vorspiel und fünf Akte, Wien 1924
Die erste Beicht' und andere Novellen [aus: Aus meinem Merkbuch und Schuldbuch; Nachwort: Anton Bettelheim]. Philipp Reclam jun., Leipzig, 1924
Die Hungerblockade. Drama, 1925
Der Armendoktor. Drama, 1927
Der Spurius. Österreichische Komödie in drei Akten, Wien 1927
Herr Doktor, haben Sie zu essen? Drama, 1930
Passionsspiel. Drama, 1933
Die Fahne weht. Schauspiel in drei Akten, 1937
Verfilmungen:
Der Judas von Tirol. 1933, 1978, 2006.
Erde. Drehbuch: Eduard Köck, Regie: Leopold Hainisch, Coproduktion Österreich/Schweiz, 1946/47.
Der Weibsteufel. 1920, 1924, 1951, 1966, 1983, 1984, 2000, 2009, 2012 (unter dem Titel Grenzgänger und englisch She-Devil).
Die Bildschnitzer – eine Tragödie braver Leut´. Spielfilm/Fernsehen, Drehbuch und Regie: Luis Walter, RAI Sender Bozen, 2001.
Weiters im Grab bestattet:
Malvine Luise Schönherr, geb. Perlsee, * 19.11.1867, † 1956, Bestattungsdatum: 13.02.1956
Schönherr-Runde: Im Lauf der Jahre trafen sich im Restaurant an der Währinger Straße 67 (heute Haus Zakeri) von Josef Pohl wiederkehrend Gruppen, Verbandsmitglieder und Vereine. Besonders hervorzuheben ist die SCHÖNHERR-Runde, der Wiener Künstlerklub mit seinem Stammtisch, Josef Pohl war ein Duzfreund von Doktor Karl Schönherr. Zu den "Mitgliedern" der Runde zählten der Arzt und Schriftsteller Karl Schönherr, Opernsänger Baritonist Dr. Emil Schipper, (Vorsitz, ein Schüler Winkelmanns), seine Frau Maria Olszewska, Medizinalrat Dr. Friedrich Schreiber, der Burgschauspieler Walter Huber, Krankenkassenbeamter und Gemeinderat Friedrich Schleifer, Chefredakteur Maximilian Schreier, Advokat Dr. Paul Klemperer, Schauspieler Ernst Wurmser und natürlich Kommerzialrat Josef Pohl, der Besitzer des Theater-Restaurants.
Allgemeine Sport-Zeitung vom 11.4.1915, Seite 212: DER »WEIBSTEUFEL«. Im Burgtheater wird jetzt Schönherrs »Weibsteufel« gegeben, eine mehrfache Merkwürdigkeit: ein fünfaktiges Drama mit nur drei Personen, und ein Stoff, der zum Widerspruch herausfordert. Welchen Zweck hat es, die menschliche Brunft in wildestem Grade und in widerlichster Natürlichkeit auf die Bühne zu bringen und damit fünf Akte zu füllen? Daß ein physischer Übermensch, ein kraftstrotzender Prachtkerl, eine Art Musterzuchthengst der Gattung Mensch auf ein gleichfalls kerngesundes, starkes, junges Weib voll Leben und Blut eine viel stärkere geschlechtliche Anziehungskraft ausübt als ein schwaches, kränkliches Männchen, das anderen nur im Verstande und der Pfiffigkeit über ist, und daß die in einem solchen Weibe dann erst erwachte rein tierische Sinnlichkeit bis zu hellen Flammen auflodern kann, das bedurfte doch nicht erst eines Nachweises in dramatischer Form. Man kennt von den größten Malern aller Zeiten auch Zeichnungen und Bilder, die gleich wohl nicht öffentlich gezeigt werden dürfen. Weshalb das, wenn es wahr ist, daß die Kunst alles adelt, jeden Stoff? Man erzählt von einem Maler, der einst als Stilleben einen Haufen menschlicher Exkremente mit so packender Naturtreue dargestellt hat, daß sich die Beschauer unwillkürlich an die Nasen griffen, um sie zuzuhalten. Gewiß war das auch Kunst und dieses Bild ein malerisches Meisterwerk. Wer aber hängt ein solches Gemälde in seinen Salon? Was hat es für einen Zweck, ein großes Können für einen solchen Stoff zu vergeuden? Ähnlich ist es mit dem »Weibsteufel« von Schönherr. Das Stück ist zweifellos in seiner Art ein hervorragendes Werk, allerdings mit verhautem Schluß, und es wird von unseren Burgkünstlern ganz meisterhaft gespielt. Insbesondere Frau Medelsky bietet eine Leistung von außerordentlicher Größe und schauspielerischer Kraft. Ist aber eine solche Gattung von Theaterdichtung wünschenswert? Zur Bildung und zur Veredlung der Gemüter und des Geistes trägt doch ein solches Werk nicht bei! Wo bleibt da die höhere Aufgabe der Kunst und des Theaters? Jedenfalls aber — wenn schon auch solche Dichtung auf der Bühne gepflegt werden soll — ist das kein Stück für das Burgtheater. Man ist dort jetzt schon sehr weit gegangen in der so genannten modernen Richtung, daß man aber auch noch diesem »Weibsteufel« die Pforten der Hofbühne erschlossen hat, daß man ihrem Publikum diesen Stoff vorführt, darf wohl wundernehmen. Wohin werden wir da noch kommen? Der Kritiker der »Neuen Freien Presse« sagt über das Stück: »Aber auch den ländlichen Rock empfindet man diesmal fast als ein Zuviel. Man möchte dem Manne seinen Kittel, dem Weibe das Mieder ausziehen; das Stück, wenn es die Sitte erlaubte, müßte eigentlich im adamitischen Kostüm dargestellt werden, damit zwischen Mensch und Natur jede Scheidewand fiele, zwischen uns und unserem Triebleben die letzte dünne Kulturschichte dahinschwände.« Die Sitte ist aber auch etwas wandelbares. Sie hat sich schon gar mannigfach gehäutet. Vielleicht kommt daher noch einmal eine Zeit, wo man bei Stücken, die es erfordern, auch auf die Bekleidung der Darsteller verzichtet V.S.
Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe) vom 16.3.1943, Seite 2: Karl Schönherr. Wie wir eriahren. ist Karl Schönherr am 15. d. in seiner Wiener Wohnung nach längerem Siechtum, sechsundsiebzig Jahre alt, gestorben. Die Nachricht, daß Karl Schönherr gestorben ist, kommt nicht unerwartet. Schon seit längerer Zeit kränkelte er, und es mag auf diese physische Ursache zurückzuführen sein, daß er in seiner Schaffenskraft in den letzten Jahren so nachgelassen hatte. Einst zählte Schönherr zu den fruchtbarsten Dichtern Oesterreichs. Seine engere Heimat war Tirol, und so hat er denn auch den vielen urwüchsigen Gestalten des schönen Landes den Odem dichterischen Lebens eingehaucht. Für uns verbindet sich mit dem Namen Schönherr das Charakterbild eines tirolischen Dichters voll bluthafter Eigenart. Immer ist es die Liebe zur Heimat, die seine Werke durchdringt, und es sind die, Begriffe Erde und Volk, die sie kennzeichnen. Es mag sein, daß ihm gerade das Leben in der Großstadt, fern von seinem Zuhause, die Liebe zur Heimat erst so richtig erweckte. Und dieses Heimweh schrieb er sich von der Seele, indem er die Nordtiroler Berge oder das Passeier Tal im Geist vor sich sah. Es war die schöpferische Kraft der Sehnsucht, die ihm die Feder führte. Und weil er beides kannte, die Stadt und das Land, so vermöchte er wie kaum ein andrer in Werk und Wesen die einander sich fördernden Energien im Wechselbild von Stadt und Land zu veranschaulichen. In Axams bei Innsbruck, unweit von Speckbachers Heimatsdorf, wurde Schönherr am 24. Februar 1867 geboren. Seine Kindheit verbrachte er im Vintschgau, wohin seine Familie ühergesiedelt war. Ein fröhliches, seliges Kinderleben lebte er dort zusammen mit vier Geschwistern. Welch ein Kontrast zu dem späteren dürftigen Zimmerherrendasein in der Stadt! Dort bestand seine Welt aus Hörsaal, Krankenbett, Anatomie. Dieser Unterschied zu dem Leben seiner Kindheit mochte wahrlich imstande gewesen sein, Seelisches aufzurütteln. Schönherr hat seinen Medizinerdoktor gemacht. Aber schon hatte auch der Schriftsteller Schönherr seine ersten Erfolge errungen. Bis 1905 war der Dichter noch als Arzt tätig, dann wurde der Arzt Dichter. Er hatte den Beruf mit der Berufung vertauscht, und dieser blieb er treu. Schon in seinen jungen Jahren drängte es Schönherr zur dichterischen Entfaltung seiner Gedankenwelt. Eine Fülle köstlicher Gaben heiterer Art in Vers und Prosa findet sich in seinem Erstlingswerk, das im Jahre 1895 in drei Sammlungen erschien. Fast möchte man von einem Alpengarten duftender Blumen sprechen. „Inntaler Schnalzer" hießen die zuerst herausgegebenen Gedichte in Tirolet Mundart, es folgten „Allerhand Kreuzköpf" — Geschichten und Gestalten aus den Alpen —, und das dritte im Bund dieser Büchlein war „Tiroler Marterln für abg'stürzte Bergkraxler". Schon in diesen kleinen launigen Gedichten und kurzen, gleichfalls zumeist heiteren Geschichten verriet sich der geborne Dramatiker. Wie lebendig und wie von Kraft strotzend scheinen uns doch seine Tiroler „Klacheln". Neben ihnen stehen die Rüppeln und Raufer, die Säufer, die Spitzbuben und die Prahler. Manches saftige Sprüchlein wurde diesen Burschen zuteil, die ein handfestes Volk tirolischer Menschen darstellen. In aller Kraft und Kernigkeit ist immer auch viel Herzlichkeit enthalten. Und in mitten all des Uebermutes und der draufgängerischen Lustigkeit finden wir immef auch ein feihes Körnchen Wehmut. Es ist eine alte Wahrheit, daß sich das Leben der Kindheit im späteren Leben aufs neue widerspiegelt. Bei einem Dichter wird sich die Welt seiner Kindheit in seinen Werken widerspiegeln. Die Gestalten, die Schönherr in seiner Jugend sah, lebten später in seinen Werken abermals auf. Seine Mutter, die es als Lehrerswitwe schwer gehabt hatte, ihre fünf Kinder großzuziehen, war eine geborne Suitner, Schönherr hat ihren Namen verherrlicht in einem seiner prächtigsten Schauspiele; „Frau Suitner." Lang vorher schon widmete er seiner Mutter, der es versagt geblieben war, den Dichterruhm ihres Sohnes zu erleben, ein Gedichterl; „Mei Muatterle hob'n s’ mer begrob'n, in der Eil und im Winter, im Schnee..." Eine andre Gestalt aus seiner Jugend war der Kreuzwirt von Schlanders. Er begegnet uns im „Judas von Tirol". Und wahrscheinlich waren das Eishofbäuerl und das Totenweiberle und der alte Gruz und die herbe Wirtschafterin Mena auch persönlich Bekannte des Dichters. Karl Schönherrs Dramen sind aus der naturalistischen Sphäre erwachsen. Der Stoff triumphierte, er wurde zum Zweck. Es wäre nun ein leichtes, von einer stofflich bedingten Sphäre zu sprechen und damit die Kunst Schönherrs gewissermaßen zu begrenzen. Aber Schönherr war daneben zu sehr Dichter im ethischen Sinn, als daß er sich beengen hätte lassen, als daß er sich zu sehr auf das rein Zweckmäßige dieser Richtung festgelegt hätte. Es schwingt bei allem Naturalismus und inmitten des Realismus auch ein rein Dichterisches immer mit. Vor allem war Schönherr ein grandioser Dramatiker, ein vollendeter Techniker. Zu seinen echtesten Dramen ist etwa „Erde" zu zählen. In „Glaube und Heimat" oder in „Volk in Not" kommt bereits etwas Stilisiertes hinzu, etwas, das man das Holzschnittmäßige nennt. Man hat deshalb oft die Entwicklung Schönherrs mit der eines andern großen Tirolers verglichen, mit Egger-Lienz. Allein aus diesem Vergleich geht freilich schon hervor, daß der erwähnte Hinweis auf das Stilisiert-Holzschnittmäßige keinen Tadel bedeuten sollte, viel mehr wollte man damit feststellen, daß sich auch bei Schönherr eine Wandlung vom Individuellen zum Typischen vollzogen habe. Was allein ein solches Typisches bei den Frauenqestalten Schönherrs bedeutet, davon zeugen die schon erwähnte „Frau Suitner" und dann der „Weibsteufel". Es ist gerade dieser „Weibsteufel", der uns abermals an das eminent große Können Schönherrs erinnert. Nur drei Personen stehen auf der Bühne. Nur zwei Personen spielen in dem Drama „Es". In der „Kindertragödie” begegnen wir wieder drei Personen. Es gehört eine meisterhafte Technik dazu, mit solch einem dürftigen Personenverzeichnis ein Stück zu füllen, und es ist die Oekonomie, wie sie an altgriechische Tragödien erinnert, die dies ermöglicht. Die Geschlossenheit und Dichtheit des dramatischen Gefüges treffen wir dann auch noch bei Ibsen an. Es ist sichtlich dessen Schule, durch die Schönherr gegangen ist. Schönherr hat sich von Anfang an weit vom sogenannten Bauerntheater entfernt. Er hat nicht für das Bauerntheater, er hat für die Volksbühne geschrieben. Man muß in diesem Zusammenhang an seine getreuesten Interpreten erinnern, an die Exl-Leute. Sie waren es, die sich als erste um des Dichters Werk angenommen hatten und die fähig waren, es zu vermitteln. Schönherrs Dramen — wir nennen noch die „Bildschnitzer", „Karrnerleut", „Herr Doktor, haben Sie zu essen ?", „Der Armendoktor" und das letzte seiner Schauspiele, „Die Fahne weht" — boten einer Schauspielergeneration, die mit ihm zugleich groß geworden, dankbarste Aufgabe. Voreilige meinten vor einiger Zeit, daß diese Generation nun aber bereits auf den Aussterbeetat zu setzen sei. Es hat sich diese Ansicht, sehr bald als unrichtig erwiesen. Vor kurzem begingen die Exl das vierzigjährige Jubiläum des Bestandes ihrer Bühne. Da stand selbst verständlich Karl Schönherr auf dem Programm. Man gab seine „Erde". Und siehe da — die Wirkung war die gleiche, die dieses Stück einst erzielt hatte, als Schönherr noch „modern" war. Zu groß ist seine Kunst, zu vollendet seine Technik, als daß seine Dramen sich so leicht entbehren ließen. Schönherr ist gestorben, sein Werk lebt. G. von Stigier-Fuchs.
Völkischer Beobachter vom 21.3.1943, Seite 7: Allen Verwandten, Freunden und Bekannten geben wir die tiefbetrübende Nachricht von dem Ableben unseres innigstgeliebten und unvergeßlichen Gatten, bzw. Stiefvaters-, des Herrn Dr. Karl Schönherr Ehrenbürger von Axams, Ehrenmitglied der Akademie der bildenden Künste in Wien, Mitglied der Preußischen Akademie der Künste, Besitzer der Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft, Ritter des Franz-Joseph-Ordens, Träger des Burgtheaterringes, des Ehrenringes der Stadt Innsbruck und anderer hoher Auszeichnungen, welcher Montag, den 15. März 1943, um 14 Uhr 15 Minuten im 77. Lebensjahre nach langer, schwerer Krankheit und Empfang der Sterbesakramente sanft entschlafen ist. Die Beisetzung findet Dienstag, den 23. März 1943, um 15 Uhr auf dem Zentralfriedhof nach erfolgter Einsegnung in der Dr.-Karl-Lueger-Gedächtniskirche in einem Ehrengrabe der Stadt Wien statt. Die Seelenmesse wird Mittwoch, den 24. März 1943, um 10 Uhr in der Schottenkirche gelesen werden. Malwine Schönherr, Wien, IX., Severingasse 5, Dr. Ludwig Chiavacci, Vinzenz und Stefanie Chiavacci, Wien, VI., Amerlingstr. 19. Wien, den 16. März 1943.
Quelle: Dieser Text basiert auf dem Artikel Karl_Schönherr aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 4.0 (Text erweitert). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bilder: www.nikles.net, Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe) vom 16.3.1943, Seite 2, Völkischer Beobachter vom 21.3.1943, Seite 7 und gemeinfrei.
Willkommen
Danke, dass Sie unsere Webseite ausgewählt haben.
Wir freuen uns, Sie hier zu haben und möchten unser Wissen mit Ihnen teilen.
Sie können uns gerne zu verschiedenen Themen unter der Email office@nikles.net schreiben.
Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.
Die meisten Bilddateien sind aus eigener Quelle und können auf Anfrage kostenlos für eigene Webseiten verwendet werden.
Auf Wunsch auch in höherer Auflösung.
Kontakt
Günter Nikles
Josef Reichl-Str. 17a/7
7540 Güssing
Austria
Email:
office@nikles.net
Website:
www.nikles.net
(c) 2026 www.nikles.net