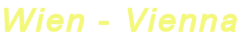03. Bezirk - Arsenal
Das Arsenal ist ein ehemaliger militärischer Gebäudekomplex im Südosten von Wien im 3. Wiener Gemeindebezirk Landstraße gelegen. Die mächtige aus mehreren Backsteinbauten bestehende Anlage befindet sich auf einem rechteckigem Grundriss auf der Anhöhe südlich des Landstraßer Gürtels.
Bedeutung: Sie ist die bedeutendste profane Baugruppe des Romantischen Historismus in Wien und wurde in italienisch-mittelalterlichen beziehungsweise byzantinisch-islamischen Formen ausgeführt. Im Wesentlichen ist die Anlage in ihrer ursprünglichen Form erhalten, lediglich die ehemaligen Werkstättengebäude im Inneren des Hofes wurden durch Neubauten ersetzt.
Geschichte: Die Anlage mit insgesamt 72 „Objekten“
(Gebäuden) wurde aus Anlass der Märzrevolution 1848 von 1849
bis 1856 erbaut und war der erste Bau des die alte Wiener
Stadtmauer ablösenden Festungsdreiecks mit der Rossauer
Kaserne und der heute nicht mehr existierenden
Franz-Joseph-Kaserne am Stubenring. Dabei wurden die
Bauwerke unter Zuweisung von Sektoren von den Architekten
Carl Roesner, Antonius Pius de Riegel, August Sicard von Sicardsburg,
Eduard van der Nüll, Theophil von Hansen und
Ludwig Förster geplant und durch Baumeister Leopold Mayr
gebaut. Das Heeresgeschichtliche Museum wurde erst 1891
fertig ausgestattet. In der Folgezeit gab es immer wieder
Erweiterungen. Während der beiden Weltkriege diente der
Gebäudekomplex als Waffenfabrik und Waffendepot, vor allem
aber als Kaserne. Der Personalhöchststand im Arsenal wurde
im Ersten Weltkrieg mit rund 20.000 Beschäftigten erreicht.
Nach 1918 wurde der militärisch-industrielle Betrieb mit
eigenem Stahlwerk in eine Gemeinwirtschaftliche Anstalt mit
dem Namen „Österreichische Werke Arsenal“ umgewandelt. Es
gab aber nahezu unlösbare Konversionsprobleme beim Übergang
zur Friedensproduktion, die Produktpalette war zu groß und
die Misswirtschaft beträchtlich. Die Mitarbeiterzahl sank
kontinuierlich, und das Unternehmen wurde zu einem der
großen wirtschaftlichen Skandalfälle der Ersten Republik.
Das Arsenal war nicht immer Teil des Bezirks
Landstraße, von
seiner Erbauung an bis ins Jahr 1938 gehörte das Areal zum
Bezirk Favoriten. Als jedoch
während des Dritten Reiches mit der Errichtung des
Reichsgaus Groß-Wien begonnen wurde, wurden der
Arsenalkomplex und die südöstlich davon gelegenen Gebiete im
Zuge von Bezirksgrenzenänderungen Teil des dritten Bezirks.
Während des Zweiten Weltkrieges wurden im Arsenal
Panzerreparaturwerkstätten der Waffen-SS eingerichtet. In
den letzten beiden Kriegsjahren wurden mehrere Gebäude
schwer durch Bombentreffer beschädigt, diese wurden nach dem
Krieg weitgehend in den ursprünglichen Formen
wiederhergestellt.
Heutige Nutzung: Vor allem im südlichen Teil und
im ehemaligen Innenhof des Arsenals kamen mehrere Neubauten
hinzu, so 1959 bis 1963 die Dekorationswerkstätten der
Bundestheater und die in den 1990er Jahren errichtete
Probebühne des Burgtheaters, 1961 bis 1963 das
Fernmeldezentralamt und 1973 Betriebs- und Bürogebäude der
Post- und Telegraphendirektion für Wien, Niederösterreich
und das Burgenland (heute Technologiezentrum Arsenal von A1
Telekom Austria) mit dem 150 Meter hohen
Funkturm Wien-Arsenal.
Auch das Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum
Arsenal, nunmehr Arsenal Research, das sich durch eine der
größten Klimakammern weltweit (inzwischen nach
Floridsdorf übergesiedelt) einen
Namen gemacht hat, war in dem Komplex untergebracht. Ein
kleinerer Teil der Anlage wird auch heute noch vom
Österreichischen Bundesheer als Kaserne genutzt. Des
weiteren ist die
Zentraldesinfektionsanstalt der Gemeinde
Wien und das Chemische Zentrallabor des Bundesdenkmalamtes
im Arsenal untergebracht. Das Heeresgeschichtliche Museum
nutzt mehrere Objekte als Depots.
Ende 2003 wurde das Arsenal im Zusammenhang mit anderen
Liegenschaften von der staatlichen
Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) an eine private
Investorengruppe verkauft. Seit Anfang 2006 sind der Badener
Anwalt Rudolf Fries und der Industrielle Walter Scherb
Mehrheitseigentümer der 72.000 m2 großen historischen
Anlage, die sie sanieren und „nach Möglichkeit neu
vermieten“ wollen. Fries plant auch, die vorhandene
Wohnfläche um mehr als die Hälfte (etwa 40.000 m2) zu
vergrößern. Ein architektonischer Ideenwettbewerb, dessen
Jury am 28. und 29. Juni 2007 tagte, erbrachte Vorschläge,
die auf weitgehende bauliche Veränderungen der Anlage hinaus
laufen. So entwarf Wettbewerbssieger Hohensinn eine
futuristische Wolkenspange nach dem Vorbild von El
Lissitzkys Wolkenbügel, eine mehrstöckige horizontale
Struktur auf schlanken Stelzen über dem Altbestand am Rande
des Schweizer Gartens.
Die Realisierung dieser Pläne gilt als unwahrscheinlich.
Siehe auch:
Arsenal, Objekt 1, Ehem. Kommandanturgebäude an der Ghegastraße, heute Wohnhaus mit Büros, Durchgangsmöglichkeit zum Heeresgeschichtlichen Museum.
Arsenal, Objekt 2, Artilleriehalle. Die Geschützsammlung umfasst rund 550 Rohre und Geschütze.
Arsenal, Objekt 3, Ecke Ghegastraße / Arsenalstraße (heute Wohnhaus).
Arsenal, Objekt 4, Langgestrecktes Depotgebäude (Tennisplätze).
Arsenal, Objekt 6, Langgestrecktes Depotgebäude an der Arsenalstraße.
Arsenal, Objekt 12, Kaserne, Heeresdruckzentrum.
Arsenal, Objekt 13, Panzerhalle. Die neue Panzerhalle zeigt die Geschichte des motorisierten Heeres.
Arsenal, Objekt 15, Langgestrecktes Depotgebäude.
Arsenal, Objekt 16, Wohngebäude an der Ghegastraße.
Arsenal, Objekt 17, Artilleriehalle.
Arsenal, Objekt 18, Heeresgeschichtliches Museum.
Arsenal, Objekt 19, ART for ART Theaterservice GmbH - Dekorationswerkstätten, Probebühne Staatsoper und Burgtheater.
Arsenal, Objekt 20, WIFO - Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung.
Arsenal, Objekt 22, A1 Telekom Austria (Futurecampus).
Arsenal, Objekt 24, A1 Telekom Austria, siehe auch Funkturm Wien-Arsenal.
Arsenal, Objekt 25, A1 Telekom Austria.
Arsenal, Objekt 202, Ballonhalle
Arsenal, Objekt 205, Heerestischlerei, aus dieser Halle wurden über eine Rollbahn im Handverschub Holzreste und Späne in ein nebenstehendes Gebäude zur Zwischenlagerung gebracht.
Arsenal, Objekt 206.
Arsenal, Objekt 207, TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH.
Arsenal, Objekt 210, Fernheizwerk Arsenal.
Arsenal, Objekt 213, OFI - Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik, Franz-Grill-Straße 5.
Arsenal, Objekt 214, Superrechenzentrum Vienna Scientific Cluster (VSC), Smart Minerals GmbH, Franz-Grill-Straße 9.
Arsenal, Objekt 219, Gebäude OD.
Arsenal, Objekt 221, ehemalige Siemenshalle. Die Siemenshalle wurde in den Jahren 1916 bis 1918 als Anlage für elektrische Hochspannungsversuche errichtet, jetzt Institut für Energietechnik und Thermodynamik, TU Wien.
Arsenal, Objekt 227, ehemalige Luftschiffhalle, diente zum Bau von Luftschiffen, jetzt: MAGNA-Halle.
Arsenal, Objekt 235, Wasserforschungslabor.
Arsenal, Objekt 236, Gebäude OC.
Quelle: Dieser Text basiert auf dem Artikel Arsenal_(Wien) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 4.0 (Text erweitert). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bilder: www.nikles.net.
Willkommen
Danke, dass Sie unsere Webseite ausgewählt haben.
Wir freuen uns, Sie hier zu haben und möchten unser Wissen mit Ihnen teilen.
Sie können uns gerne zu verschiedenen Themen unter der Email office@nikles.net schreiben.
Wir antworten in der Regel innerhalb eines Tages.
Die meisten Bilddateien sind aus eigener Quelle und können auf Anfrage kostenlos für eigene Webseiten verwendet werden.
Auf Wunsch auch in höherer Auflösung.
Kontakt
Günter Nikles
Josef Reichl-Str. 17a/7
7540 Güssing
Austria
Email:
office@nikles.net
Website:
www.nikles.net
(c) 2026 www.nikles.net